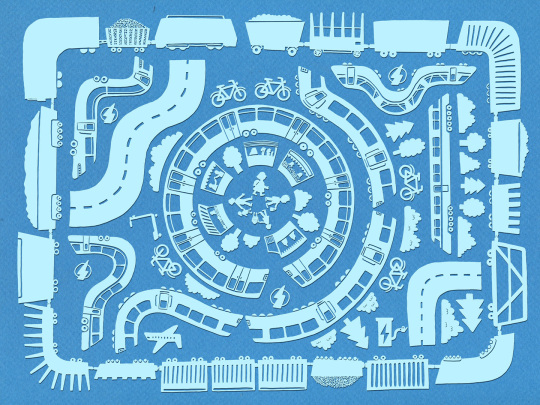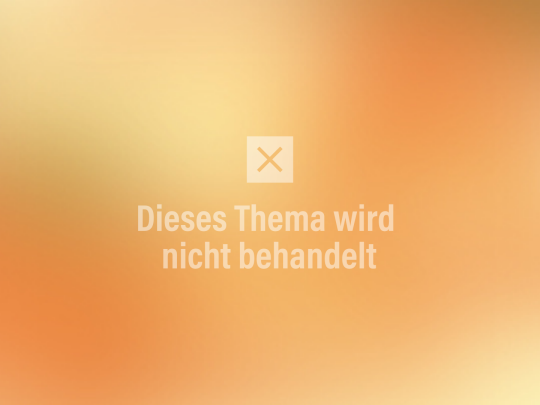Text
Robert Graeff
Maria Reinisch
Lektorat
–
Review
Hartmut Graßl
Illustration
–
2040 – Wir haben schon viel erreicht
Gemeinschaft ist 2040 wichtiger denn je. Die Zeit der gesellschaftlichen Spaltung und Individualisierung ist ersetzt durch ein kooperatives Miteinander, in dem wir zusammen an einer nachhaltigen Gestaltung der Gesellschaft arbeiten – sei es in der Region oder in ökologischen und sozialen Initiativen.
Gemeinschaft wird dabei nicht nur im traditionellen Sinne von Familie verstanden, sondern umfasst auch regionale Netzwerke und sozial- und ökologisch-relevante Faktoren. Drei relevante Themen für das neue Gemeinschaftsgefühl sind Sicherheit (finanziell, ökologisch, gesellschaftlich), Wertschätzung (Verantwortung übernehmen und gebraucht werden) und Heimat (Zugehörigkeit und Gemeinschaftssinn). siehe dazu: Reinisch, Maria (2020) Basis+ – das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen. In: Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung braucht Grundein/auskommen ermöglicht Entschleunigung ermöglicht Nachhaltigkeit. Parthas Verlag, S. 208-218.
Die Menschen werden heute regional in den Gestaltungsprozess ihrer Umgebung einbezogen und können Teile der Gesellschaft mitgestalten. Ein Schlüsselelement dabei ist das „mitgestaltende Gesellschaftseinkommen“.
Dieses zusätzliche Einkommen können Personen erhalten, die sich für die Gemeinschaft in ökologischen, gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten vor Ort engagieren. Damit bietet es insbesondere Menschen, die finanziell wenig gesichert sind, ein finanzielles Zusatzeinkommen, das produktive, wertvolle Teilhabe an der Gesellschaft erzeugt, das Engagement und das Verantwortungsbewusstsein vor Ort stärkt – sowie ein wirksames Mittel gegen Einsamkeit ist. Empfängerinnen und Empfänger dieses Zusatzes machen Sinnvolles, erhalten Wertschätzung und gehören zur Gemeinschaft.
Besonders ältere Menschen profitieren davon, da es ihnen eine sinnstiftende Einbindung in die Gesellschaft ermöglicht und größere finanzielle Sicherheit geben kann. Damit sind die „Baby-Boomer“ und die nachfolgende Generation weiterhin aktiv in die Wertschöpfung und Wertschätzung eingebunden. Doch das Modell richtet sich nicht nur an ältere Menschen. Es spricht auch andere Zielgruppen an, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt oder dem gesellschaftlichen Leben nicht oder nur schwer möglich ist.
Dr. Maria Reinisch erwähnt in einem Interview mit Adrienne Goehler folgende Kriterien: Das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen wird in Abstimmung mit den Kommunen an alle Menschen gegeben, die über 27 Jahre alt sind und mindestens 30 Stunden im Monat einem Engagement in Abstimmung mit den lokalen Institutionen, NGOs, Vereinen, usw. nachgehen. Diese Tätigkeit sollte zu den Interessen und Voraussetzungen jedes Einzelnen passen bzw. adaptiert werden. Vgl. Reinisch, Maria (2020) Basis + – das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen, in: Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung braucht Grundein/auskommen ermöglicht Entschleunigung ermöglicht Nachhaltigkeit. Parthas Verlag, S. 208-218.
Das Wettbewerbslevel, die Angst um einen Jobverlust und die damit verbundene Prekarität sind bis heute erheblich gesunken. Die allgemeine Zufriedenheit und die durchschnittliche, psychische Gesundheit haben sich dadurch in der Gesellschaft verbessert.
Bereits 2024 konnten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einer Modellstudie anhand von Daten und Umfragewerten aus Großbritannien feststellen, dass ein „Universal Basic Income“ positive Effekte bei der psychischen Gesundheit, speziell bei Frauen und Personen mit unterdurchschnittlichem Bildungsabschluss, verzeichnen könnte. Dieser Effekt sei aber schwierig abzuschätzen.Vgl. Thomson et al. 2024: 15ff: Thomas, S. P. (2024). The Loneliness Epidemic and Its Health Consequences. Issues in Mental Health Nursing, 45(1), pp. 1-2.
Mit der wachsenden Bedeutung von Gemeinschaft geht 2040 auch die gezielte Bekämpfung ihres Gegenspielers einher: Einsamkeit. Insbesondere die in den 2020er-Jahren verstärkt auftretende soziale Isolation wird durch die oben beschriebenen neuen Konzepte erfolgreich aufgefangen.
Die Lücke, die durch die zunehmende Digitalisierung, den Einfluss sozialer Medien und die gesellschaftliche Abkehr von traditionellen Glaubensgemeinschaften entstanden ist, wird nun durch eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Zivilgesellschaft geschlossen. Gleichzeitig werden die gesundheitlichen Folgen sozialer Medien umfassender erforscht, und gezielte Aufklärung trägt dazu bei, deren negative Auswirkungen zu mildern.
Einsamkeitsgefühle konnten bereits in der Forschung bei starker Nutzung von Social Media nachgewiesen werden. Auch die Covid-19-Pandemie hat nachweislich zu verstärkten Einsamkeitserfahrungen geführt. Einsamkeit gilt als Risikofaktor für die körperliche und psychische Gesundheit und kann das Sterberisiko signifikant erhöhen. Vgl. Thomas, S. P. (2024). The Loneliness Epidemic and Its Health Consequences. Issues in Mental Health Nursing, 45(1), pp. 1-2.
Darüber hinaus werden weitere Einsamkeitsfaktoren wie die zunehmende Anonymisierung in Großstädten durch starken Zuzug und Gentrifizierung abgeschwächt. Gleichzeitig werden regionale Strukturen in ländlichen Regionen gestärkt, weil das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen eine finanzielle Absicherung bietet und gleichzeitig das regionale Miteinander und die Angebote hierfür deutlich stärkt.
Die Stärkung des Miteinanders und Füreinanders – egal ob sozial, ökologisch oder auch künstlerisch – bringt Menschen aller Generationen stärker zueinander. Damit werden auch ländliche Regionen für junge Menschen wieder interessant und lebendig.
Durch das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen und ergänzende Konzepte, wie z. B. ein verpflichtendes soziales Jahr nach dem Schulabschluss und am Anfang des Renteneintritts, spielen die Zivilgesellschaft und das Miteinander eine zentrale Rolle im Gemeinschaftsmodell der heutigen Zeit.
Deutlich mehr Leistungen und Aufgaben des Staates sind erfolgreich auf regionale Strukturen übertragen worden – seien es Vereine, NGOs und ehrenamtliche Engagements. Das fördert nicht nur das Miteinander und die Selbstwirksamkeit, sondern entlastet auch den Staat. Diese zivilgesellschaftlichen Strukturen sind regional und intergenerationell organisiert, um zusätzlich die Einbindung und das Miteinander in der Gemeinde zu stärken.
Ein Fallbeispiel zum Potenzial der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme von zivilgesellschaftlichen Akteuren ist die Tafel e. V.: In einer Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass mit hoher Zufriedenheit ein großer Teil der Kund:innen der Tafel e. V., die sonst von Ernährungsunsicherheit betroffen wären, wichtige Lebensmittel über die Organisation erhalten. Zusätzlich dient die Tafel e. V. auch als Beispiel für ein zivilgesellschaftliches Engagement in Richtung einer zirkulären Wirtschaftsweise, da sie überschüssige Lebensmittel an 2 Mio. Bedürftige jährlich verteilt. Jährlich fallen in Deutschland 11 Mio. Tonnen Lebensmittelabfälle an, die größtenteils vermieden werden könnten. Vgl. Diekmann, M., et al. (2024) ‚Die Bedeutung von Lebensmitteln, die über die Tafeln‘, in: Nachhaltige Ernährungssysteme und Landnutzungswandel, S. 411-415.
Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten
Der Weg zu dieser neuen Gesellschaftsstruktur war von einem tiefgreifenden Wertewandel geprägt. Denn lange galt der Grundsatz: „Machst du was, bist du was.“ Während dieser Satz weiterhin Bestand hat, wurde seine Bedeutung grundlegend erweitert. Begriffe wie „Leistung“, „Produktivität“ und „Wachstum“ wurden um mehrere Aspekte ergänzt.
In die Definition des Grundsatzes „Machst du was, bist du was“ gehören auch das „Miteinander“, „Wohlfühlen in der Region“, „gesellschaftliches Engagement“ und „Zufriedenheit“. Damit wurden die gesellschaftlich wertvollen Tätigkeiten jenseits der klassischen Erwerbsarbeit genauso wie die sogenannte Care-Arbeit wesentlicher Bestandteil des Wertesystems.
Mit diesen neuen Vorstellungen wurde eine Transformation des Arbeitsmarktes und der Gesellschaft eingeleitet. Zivilgesellschaftliches Engagement, politische Bildung, Unterstützung bei Pflege, Sozialarbeit, gelingendes Miteinander, aktive Stadtgestaltung oder kreative Tätigkeiten zur Bereicherung der kulturellen Landschaft konnten finanziell mit der Einführung des mitgestaltenden Gesellschaftseinkommens anerkannt werden.
In Absprache mit der Deutschen Rentenversicherung und der Bundesagentur für Arbeit wurde eine Koordinationsstelle gegründet, die die Einkünfte aus Grundsicherung und Bürgergeld der jeweiligen Person überprüfen und dann mit dem mitgestaltenden Gesellschaftseinkommen aufstocken. Dieses zusätzliche Einkommen kann bei der Koordinationsstelle beantragt werden, sofern die antragstellende Person 27 Jahre alt ist und nachweisen kann, dass sie monatlich mindestens 30 Stunden arbeitet. Diese Maßnahme hat die Bundesregierung eingeführt, um den Verlust von Arbeitsplätzen infolge der rapiden Zunahme der Digitalisierung und Technologisierung durch künstliche Intelligenz abzuschwächen. Vgl. Dahlin, Eric (2024). „Who Says Artificial Intelligence Is Stealing Our Jobs?.“ Socius 10 (2024): 23780231241259672.
Ebenfalls wurde aufgrund der neuen, durch den Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine entstandenen Sicherheitslage in Europa eine Wehrpflicht nach dem schwedischen Modell eingeführt.
Menschen, die nicht im Musterungssystem für die Bundeswehr aufgenommen wurden, können alternativ ein soziales Jahr absolvieren. Dieses kann ebenfalls beim Renteneinstieg absolviert werden. Somit wurde ein weiterer Pfeiler gemeinschaftlicher Arbeit geschaffen.
Strand, Sanna. „The“ Scandinavian model“ of military conscription: a formula for democratic defence forces in 21st century Europe?.“ (2021): 13.
Regionale Strukturen, neue Maßnahmen und die Bekämpfung von Einsamkeit begünstigten die Schaffung eines Miteinanders und eines neuen Verständnisses von Produktivität. Statt ‚Wettbewerb‘ allein hat die Regierung zusammen mit der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft auch ‚Kooperation‘ als Ziel im Arbeitsmarkt etabliert.
Schragmann, H. (2024) Produktivität neu denken: Vom Trennungs- zum Vermittlungsbegriff. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
Ein zentrales politisches Instrument in dieser Entwicklung war das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen, das die Transformation des Wirtschaftssystems in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft unterstützte. Hierbei entstanden Synergieffekte – das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen half, das Wirtschaftssystem in eine Kreislauflogik zu bringen, indem Arbeitsplatzverluste, die durch Künstliche Intelligenz und Digitalisierung entstanden, gemindert wurden.
Digitale Technologien wurden fortan als Anlass zu mehr Effizienz genommen und als eine Möglichkeit angesehen, den Arbeitsmarkt zu transformieren und gleichzeitig die regionale Gemeinschaft und das Wohlergehen zu stärken.
Die Forschung zu den Folgen der Künstlichen Intelligenz für den Arbeitsmarkt ist sich dazu noch uneinig. Vgl. Du, J. (2024). The impact of artificial intelligence adoption on employee unemployment: A multifaceted relationship. In: International Journal of Social Sciences and Public Administration, 2(3), S. 321-327.
Die Entscheidung zum mitgestaltenden Gesellschaftseinkommen entstand auf der Grundlage verschiedener gesellschaftlicher Veränderungen, die zu einer Neubewertung eines solchen Systems führten.
Die Notwendigkeit wirtschaftlicher Transformation von Regionen und Änderungen des Arbeitsmarktes einerseits und die dürftigen Notreparaturen am Sozial-System, der Unmut über die mangelhafte Funktionalität des Bürgergelds, zunehmende Altersarmut und eine zunehmende gesellschaftliche Desintegration andererseits erzeugten den Bedarf einer neuen Lösung im Sozialsystem.
Ein erstes Pilotprojekt des mitgestaltenden Gesellschaftseinkommen wurde eingeführt und wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse stellten eine positive Bilanzierung in Aussicht.
Viele der Teilnehmenden leisteten mehr als die geforderten 30 Stunden im Monat. Die daraus resultierende Wertbildung und die durch die finanzielle Spritze erhöhte Konsumkraft einschließlich damit verbundener steuerlicher Betrachtungen waren ausschlaggebende Faktoren. Die Finanzierung für das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen wurde von Bund, Ländern und Kommunen beschlossen nach Empfehlungen der Wirtschaftsweisen, also dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und nach ökonomischen Kalkulationen des Deutschen Instituts für Wirtschaft, die sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands im Kontext neuer Technologien und Künstlicher Intelligenz befassten und ebenfalls eine positive Bilanz zogen.
Die Finanzierung sei insgesamt günstiger als die bisherigen Versuche, den Sozialstaat zu retten.
Die Finanzierung erfolgt gemeinsam von Bund, Ländern und Kommunen. Das Projekt wurde auf zwei Legislaturen als nationaler Testversuch beschlossen, um im Anschluss das Modell ggf. anzupassen und zu optimieren.
Zu der finanziellen Bilanzierung des mitgestaltenden Gesellschaftseinkommens sind Stand heute keine abschließenden Studien vorhanden. Es gibt jedoch Ansätze aus der Forschung zum bedingungslosen Grundeinkommen, die Indizien darauf geben, ob und wie eine Finanzierung möglich ist.
So sei ein Pareto-Optimum, also ein ökonomisches Plus gegeben, wenn durch das mitgestaltende Gesellschaftseinkommen negative Effekte auf folgende Kriterien ausgeschlossen werden können:
01 – Realeinkünfte von Arbeiter:innen im primären und sekundären Sektor und von Arbeitslosen
02 – Arbeitslosenrate
03 – Umsatz im Arbeitsmarkt
04 – Reales Bruttoinlandsprodukt Groot, L.F.M., Peeters, H.M.M. (YEAR MISSING!) A model of conditional and unconditional social security in an efficiency wage economy: the economic sustainability of a basic income.“ Journal of Post Keynesian Economics 19.4: 573-597.
Auch im Bereich der sozialen Medien wurden gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung von Einsamkeit verstärkt.
Besonders junge Menschen sind von Einsamkeitseffekten betroffen.
Siehe dazu: Neu, Claudia, Küpper, Beate, Luhmann, Maike (2023): „Extrem einsam? Eine Studie zur demokratischen Relevanz von Einsamkeitserfahrungen unter Jugendlichen in Deutschland„
Es wurden beispielsweise neue Aufklärungsprogramme eingeführt und bestehende Programme finanziell unterstützt.
Speziell geschulte Bildungsbeauftragte – ähnlich wie in der Suchtprävention bei Alkohol im Rahmen der Kampagne „Alkohol – Kenn dein Limit“ oder bei verpflichtenden Programmen wie der Radfahrprüfung oder der Sexualerziehung – informieren über die Zusammenhänge zwischen Social Media und Einsamkeit und sensibilisieren für einen bewussteren Umgang Kenn dein Limit (2025). Startseite, eingesehen unter: https://www.kenn-dein-limit.de/. Bereits gestartete Projekte, wie z. B. das Projekt „Medienhelden“ oder „Juuuport“, die Mobbing-Prävention und Aufklärung über digitale Medien vorantreiben, wurden erheblich verstärkt. Vgl. Juuuport (2025). Über uns, eingesehen unter: https://www.juuuport.de/ueber-uns.
Diese tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen legten den Grundstein für das heutige verstärkte Gemeinschaftsmodell, das 2040 unsere Gesellschaft prägt.