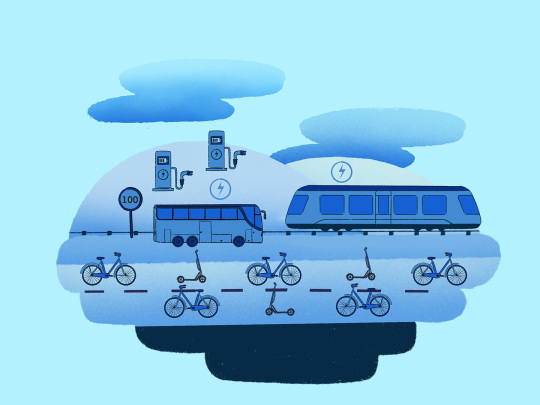Text
Hubert Weiger
Lektorat
–
Review
Hartmut Graßl
Illustration
–
2040 – Wir haben schon viel erreicht
Im Jahr 2040 leben wir in einer Gesellschaft, die von einer dynamischen Vielfalt politischer und zivilgesellschaftlicher Akteure geprägt ist. Die große Transformation der 2020er Jahre hat ein politisch-wirtschaftliches System hervorgebracht, das von Zusammenarbeit, Transparenz und demokratischer Teilhabe geprägt ist. Parteien, Verbände und Organisationen des sozialen Bereichs (Sozialverbände), des Kulturbereiches (z.B. der Deutsche Kulturrat) und der Wirtschaft (Handwerkskammern, Industrieverbände) sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie Kirchen und Nichtregierungsorganisationen (NROs), wie der BUND, sind zentrale Säulen dieser neuen zivilgesellschaftlich und demokratisch geprägten Ordnung.
Zivilgesellschaft bezeichnet den Bereich der Gesellschaft, der außerhalb von staatlichen Institutionen und der privaten Wirtschaft existiert. Sie umfasst Gruppen, Organisationen und Initiativen wie Vereine, Verbände, NROs, soziale Bewegungen und engagierte Einzelpersonen, die aktiv zur Gestaltung des öffentlichen Lebens beitragen.
Nichtregierungsorganisationen (NROs) sind vom Staat unabhängige Organisationen, die sich für gesellschaftliche, ökologische oder politische Ziele einsetzen, ohne Teil der staatlichen Verwaltung zu sein.
Etablierte politische Parteien haben sich grundlegend reformiert, um den Anforderungen einer nachhaltig orientierten Gesellschaft gerecht zu werden. Sie agieren nicht mehr als starre Institutionen, sondern als offene Plattformen für den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Und haben innovative Ansätze für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit entwickelt und politisch wirkungsvoll gemacht.
Verbände und NROs spielen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung von politischen Prozessen. Sie fungieren als Brückenbauer zwischen der Bevölkerung und den politischen Entscheidungsträgern, fördern Aufklärung und bieten Räume für gesellschaftliche Debatten. Politische Stiftungen und Denkfabriken (Think Tanks) unterstützen den Transformationsprozess durch wissenschaftlich fundierte Analysen und Strategien.
Die Gesellschaft hat den Wert einer freiheitlichen Demokratie viel stärker erkannt, weil nur sie Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und politische Teilhabe (durch direkte Bürgerbeteiligung auf allen politischen Ebenen) garantiert. Organisationen, die eventuell verfassungsfeindlich sind, werden stärker überwacht und beim Überschreiten von Grenzen durch das Verfassungsgericht verboten. Dies geschieht im Einklang mit den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und unter Einbeziehung präventiver Bildungsmaßnahmen, die demokratische Werte stärken.
Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten
Der Wandel begann in den frühen 2020er Jahren, als die Gesellschaft erkannte, dass bestehende politische Strukturen nicht ausreichen, um die globalen Herausforderungen zu bewältigen. Bewegungen für Klimagerechtigkeit, soziale Teilhabe und Demokratie setzten Impulse, die weit über die Proteste hinaus wirkten. Diese Pionierinnen und Pioniere des Wandels schufen neue Formen politischer Partizipation und stärkten das Vertrauen in demokratische Prozesse, z.B. durch Umsetzung der Ergebnisse von Bürgerräten und durch den Ausbau demokratischer Mitwirkungsrechte in Bürger- und Volksbegehren in allen Verfassungen der Bundesländer und des Bundes
Pionierinnen und Pioniere des Wandels aus der Zivilgesellschaft spielen gerade am Anfang eines transformativen Prozesses eine bedeutende Rolle. Indem sie Vorbilder schaffen, motivieren sie andere, ihre Einstellungs- und Verhaltensmuster zu verändern. Sie finden Nachahmer und stoßen den Kurswechsel „von unten“, also dezentral anWBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. (2011): Hauptgutachten. Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Berlin: WBGU.. Damit schaffen sie Akzeptanz für die damit verbundenen Veränderungen bei den Bürgerinnen und BürgernRat für Nachhaltige Entwicklung (2021): Klimaneutralität. Optionen für eine ambitionierte Weichenstellung und Umsetzung. https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2021/06/RNE_Leopoldina_Positionspapier_Klimaneutralitaet.pdf.
Parteien öffneten sich für basisdemokratische Strukturen und integrierte Bürgerforen und partizipative Entscheidungsmodelle. Die zentrale Rolle der Bürgerräte wurde immer deutlicher und führte zu ihrer dauerhaften Etablierung. Damit wurden erstmals repräsentative Querschnitte der Bevölkerung in politische Entscheidungsprozesse transparent eingebunden. Sie ermöglichten es, komplexe gesellschaftliche Fragen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und konsensorientierte Lösungen zu entwickeln.
Bürgerräte gibt es als „Instrument der dialogischen Bürgerbeteiligung” schon seit den 70er Jahren. Mit Beginn der 2020er Jahre wächst ihre Bedeutung zunehmend. Die losbasierten Bürgerräte erreichen auch Menschen, die ansonsten in politischen Debatten unterrepräsentiert sind. Das Ziel ist, eine diverse und repräsentative Gruppe zu bilden, die anschließend zum festgelegten Thema Handlungsempfehlungen entwickelt. Bürgerräte können auf kommunaler, Länder- oder sogar Bundesebene einberufen werden.
Verbände und NROs gewannen an Einfluss, indem sie als Vermittler zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik agierten. Sie trugen dazu bei, gesellschaftliche Anliegen in konkrete politische Maßnahmen zu übersetzen.
Die Schaffung des Klagerechts für Verbände in Umsetzung des Artikels 20a des GG führte z.B. für anerkannte Naturschutzverbände zu deutlichen Verbesserungen des Vollzugs vorhandener Schutzgesetze durch Sicherung der Gemeinwohlbelange und insgesamt zu einer deutlichen Verringerung des Vollzugsdefizits im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, das vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) schon Ende der 70er Jahre als zentrale Ursache für das Nichterreichen staatlicher Ziele im Bereich des Natur- und Umweltschutzes erkannt worden warDer Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1978): Umweltgutachten 1978. https://multimedia.gsb.bund.de/SRU/Dokumente/1978_Umweltgutachten.pdf.
Die staatlichen Institutionen übernahmen eine aktive Rolle, indem sie durch Gesetz Rahmenbedingungen für Transparenz und Mitbestimmung schufen. Internationale Kooperationen und lokale Netzwerke entwickelten gemeinsam Strategien zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Der Wandel wurde von einer neuen politischen Kultur getragen, die auf Transparenz, Dialog, Kooperation und langfristigem Denken basiert.
Die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen wurden durch gemeinsames Agieren aller Politikbereiche überwiegend erfolgreich umgesetzt. Gute Regierungsführung (Good Governance) und die damit verbundene Überwindung von Ressortegoismen wurden auf allen Ebenen zur Grundlage tragfähiger, nachhaltiger, ganzheitlicher Lösungen.