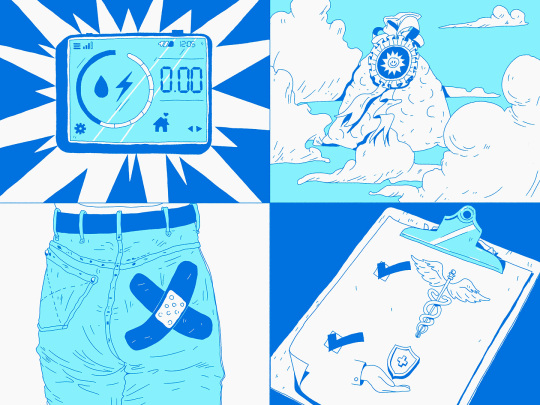Text
Christine Schmidt
Michaela Vieser
Lektorat
–
Review
Hartmut Graßl
Illustration
–
2040 – Wir haben schon viel erreicht
2040 leben wir in einem Land, dem ein kognitiver Wandel der Gesellschaft gelungen ist. Unabhängig von Leistungsparadigmen und sozialer Herkunft werden Lernprozesse, insbesondere als persönliche Entwicklungen von Individuen während ihrer gesamten Lebenszeit, ermöglicht und unterstützt. Bildung dient inzwischen somit zur Entfaltung individueller Potenziale, die zu nachhaltigen Entwicklungen in den Gemeinschaften, der Gesellschaft inklusive Wirtschaft, in hohem Maße beitragen.
Die Bedeutung der Bildung wird zunehmend deutlicher. So wurde diese u.a. in einer Studie zu Lebenswegen und Zufriedenheit junger Erwachsener als ein entscheidender Schlüssel für zufriedenes Leben identifiziert: „Hervorzuheben ist wiederum die überwältigende Bedeutung von Bildung für alle Lebensbereiche.“ Allmendinger, J., J. Haarbrücker, F. Fliegner. 2013. Lebensentwürfe heute. Wie junge Frauen und Männer in Deutschland leben wollen. Kommentierte Ergebnisse der Befragung 2012. Discussion Paper. P 2013–002. September 2013, S. 21. Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2013/p13-002.pdf.
Auch generationenübergreifend und in der Perspektive auf nachfolgende Generationen wird gleichzeitig dem Lernen und der Offenheit für Neues von der großen Mehrheit der Deutschen ein hoher Stellenwert eingeräumt: „Die größte Aufgeschlossenheit aber zeigen die Befragten bei ihrer Einstellung zum lebenslangen Lernen. Über 70 Prozent sagen, dass sie offen sind, ein Leben lang etwas Neues zu lernen. Und fast 90 Prozent empfehlen diese Offenheit nachfolgenden Generationen. Lebenslanges Lernen ist ein Wert, auf den sich fast alle Befragten einigen können. Eine Norm, auf die man sich verständigt hat.“ Allmendinger, J. 2019. Das Vermächtnis: Wie wir leben wollen. Und was wir dafür tun müssen. Ergebnisse 2019; die große Studie von Die Zeit, infas, WZB / herausgegeben von Die Zeit, Hamburg. INFAS Institut für Angewandte Sozialwissenschaft, Bonn, WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung – Social Science Research Center Berlin. Folge 4. S. 32. https://live0.zeit.de/infografik/2019/Vermaechtnis-Studie_Broschuere_2019.pdf
Alle erreichen inzwischen das ihnen mögliche Basiswissen. Für diese Basis und auch in der weiterführenden Bildung bestehen nun Lernkulturen, die individuelle, auch zeitlich selbstgesteuerte Lernprozesse erlauben und gezielt fördern. Sie dienen u.a. dem Erwerb von Gestaltungskompetenzen, insbesondere zur freiwilligen Verantwortungsübernahme. In diesem Zusammenhang wächst die Vielfalt an Lernformen beständig, wie auch das Vertrauen in Lernbereitschaft und Zutrauen in Lernfähigkeiten gewachsen sind.
In der UN-Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung wurden in den Jahren 2005 bis 2014 Themen in allgemeinbildenden Schulen unterrichtet, die sich bereits zu Krisen entwickelt hatten oder in absehbarer Zeit krisenhaft sein würden. Die seit 2000 Geborenen konnten deshalb seither einen Bildungsweg gehen, der ihnen jedes Jahr neue Lernfelder der nachhaltigen Entwicklung ermöglichte – wenn auch nicht in allen Bildungseinrichtungen die gleiche Qualität erreicht wurde. Ein Peer Review der Forschungsergebnisse identifizierte nötige Verbesserungen und stellte 2009 in der Jahrestagung des Nachhaltigkeitsrates fest: „Educators, teachers and scientific training staff should be equipped with resources to relate their present teaching and teaching materials to as many aspects of sustainability as possible. For the long term, it is necessary to empower them with special qualifications to modify the present curricular and extracurricular activities so as to comprehensively incorporate the sustainability agenda into a progressive agenda for education and vocational training.“ Stigson 2009
Dass auch unter schwierigen sozialen Bedingungen Bildung gut gelingen kann, wenn alle Verantwortlichen auf das gemeinsame Ziel hinwirken und dabei die Lernenden im Fokus haben, dafür ist der Rütlicampus ein hervorragendes Beispiel: Aus einem Negativbeispiel wurde Best Practice. https://campusruetli.de/
Bildung hat sich als zentraler Schlüssel auch bei der Bewältigung von Krisen gezeigt. Nicht nur durch Bildung in der frühen Kindheit, Schulzeit und Jugend, sondern gerade auch durch die berufliche Bildung, insbesondere durch die Weiterbildungen von Lehrenden, haben wir die für die Sicherung unserer Lebensgrundlagen nötigen Fähigkeiten aufbauen können.
Das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung – beruhend auf grundlegenden sogenannten Gestaltungskompetenzen – wurde maßgeblich von Erziehungswissenschaftler:innen im Berliner Institut FUTUR entwickelt und zunächst in der frühkindlichen und Allgemeinbildung sowie ab 2015 auch auf die berufliche Bildung angewendet, dort in Modellprojekten erprobt, weiter ausgeformt und kontinuierlich verbreitet.de Haan, G., J. Holst, M. Singer-Brodowsky. 2021. Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung – Genese, Entwicklungsstand und mögliche Transformationspfade. IN Berufliche Bildungspraxis BWP Nr. 2.2021, S. 10-14. https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/17293
Für Ausbildungsberufe gelten ab August 2021 neue Standard-Berufsbildpositionen. Alle Ausbildungsordnungen enthalten nun modernisierte und neue verbindliche Mindestanforderungen u.a. für die Bereiche Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie die digitalisierte Arbeitswelt. Für berufliche und betriebliche Lehrpersonen wurden dazu Lehr-/Lernmaterialien entworfen und durch die Projektagentur Berufliche Bildung für Nachhaltige Entwicklung veröffentlicht.PA-BBNE. 2023. Begleitmaterialien zur Beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung für über 100 Ausbildungsberufe. https://pa-bbne.de/
In Abwandlung von Comenius‘ Ideal lässt sich heute behaupten, dass alle Wichtiges lernen – so wie es ihnen möglich ist und entspricht. Auch wenn die schiere Menge des bisher entstandenen Wissens, die Realisierung von Comenius` Anspruch, alle alles zu lehren, nicht zulässt, bestehen für alle geeignete Möglichkeiten, das zu lernen, was sie für ihre eigene Entwicklung brauchen und zugleich der Gesellschaft dient.
Johann Amos Comenius hatte einst als Ideal formuliert „Alle alles ganz zu lehren“ und mit seinem Hauptwerk eine Anleitung geschrieben, wie das erreichbar ist. Noch immer sind viele seiner Thesen, etwa – dass eine gute Atmosphäre lernförderlich wirkt – grundlegend und tragfähig.Große Unterrichtslehre. Hrsg.: Karl Richter. Julius Klönne, Berlin 1871
In all ihren Formen und Facetten dient Bildung inzwischen der bewussten Gestaltung von engeren Bindungen, bestmöglichem Umgang mit sich selbst und anderen sowie dem sinnstiftenden Tun in Arbeits- und Lernprozessen. Lern- und Entwicklungsziele sind dafür entscheidender als Organisationsgrenzen
Die Soziologen Fritz Reheis und Hartmut Rosa sehen die Resonanz mit sich, anderen und der Mitwelt als Grundvoraussetzung für gelingende nachhaltige Entwicklung.
Fritz Reheis. Die Resonanzstrategie. Warum wir Nachhaltigkeit neu denken müssen. oekom verlag München 2019Reheis, F. 2019. Die Resonanzstrategie. Oekom Verlag München.
Hartmut Rosa, Wolfgang Endres. Resonanzpädagogik. Wenn es im Klassenzimmer knistert. Verlagsgruppe Beltz Weinheim 2016Rosa, H., W. Endres. 2016. Resonanzpädagogik. Wenn es im Klassenzimmer knistert. Verlagsgruppe Beltz Weinheim
Hartmut Rosa. Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp Verlag Berlin 2019Rosa, H. Resonanz. 2019. Eine Soziologie der Weltbeziehung. suhrkamp taschenbuch wissenschaft. Berlin
Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten
Der Beginn der 2020er Jahre war geprägt von der Anerkennung des Anthropozäns. Damit verbunden war die Einsicht in die Notwendigkeit großer Transformationen, die alle gesellschaftlichen Bereiche einzuschließen hatten. Mit dem Konzept der planetaren Grenzen konnte das Ausmaß der existenzbedrohenden ökologischen Krisen anschaulich dargestellt, der breiten Öffentlichkeit und politischen Entscheidungsträgern vermittelt werden. Es wurden alternative Wirtschaftsweisen beschrieben und von Pionieren erfolgreich angewendet, die sich am Erdsystem orientierten und dessen Grenzen, die in den 2020er Jahren oder zum Teil früher überschritten worden waren, achteten. Die Anteile der Branchen am Systemwechsel wurden ebenfalls berechnet. Es mussten jedoch Antworten auf die Frage gefunden werden, wie alternative Entscheidungs- und Handlungsfähigkeiten erlernt und praktiziert werden könnten, während weiter in konventionellen Routinen gearbeitet wurde.
Anthropozän wurde als Begriff von Paul Crutzen geformt, um klarzustellen, dass die Effekte des menschlichen Handelns, insbesondere die der Kohlenstoffeinträge in die Atmosphäre, eine ganze Erdepoche prägen und die Lebensbedingungen auch für Menschen negativ verändernCrutzen, P. 2002. Geology of mankind. Nature. 415. 23. https://doi.org/10.1038/415023a.
Dem folgten u.a. von Crutzen inspirierte wissenschaftliche Diskussionen zu Details der negativen Wirkungen menschlichen Handelns auf den Planeten. Diese mündeten später im Konzept der planetaren GrenzenRockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, et.al. 2009. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2): 32.
Etwa gleichzeitig wurde der Begriff „Technosphäre“ bzw. „technische Nährstoffe“ eingeführt, um zu veranschaulichen, dass alternative Wirtschaftsweisen es erfordern, in von der Biosphäre getrennten Kreisläufen zu denken, zu designen und zu (re-)produzieren. Nur auf diese Weise könnten gleichzeitig die Lebensbedingungen verbessert und die Biosphäre erhalten werdenBraungart, M. 2008. Die nächste industrielle Revolution: Die Cradle to Cradle Community. Europäische Verlagsanstalt.
Nachdem 2021 erstmals die Technosphäre schwerer wog als die Masse der Biosphäre, wurde 2022 nachgewiesen, dass menschengemachte chemische Verunreinigungen in Luft, Wasser und Böden bereits die dafür berechneten planetaren Grenzen überschritten habenPersson et al. 2022. Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021/acs.est.1c04158&ref=pdf.
Auf der Grundlage der Gestaltungskompetenzen der (beruflichen) Bildung für nachhaltige Entwicklung, mit exponentiell zunehmenden offenen Bildungsressourcen, neuen digitalen Werkzeugen auf Open-Source-Basis und den durch die Coronapandemie beschleunigt entwickelten Digitalisierungskompetenzen wurden folgenreiche Kollaborationen möglich. Mit dieser neuen Art des Zusammenarbeitens konnten sowohl Gemeinschaftsinteressen besser verfolgt und individuelle Lerninteressen gefördert als auch bisher kaum mögliche Verbindungen geknüpft und gelebt werden. So konnte berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung unter den Bedingungen der digitalen Transformation gelingen. Die Basis für die Neugestaltung von Aus- und Weiterbildungen wurde angereichert mit KI-unterstütztem individuellem Lernen, Lernortkooperationen und Weiterbildungsverbünden.
Ein Konsortium aus Bildungsforschenden und KI-Spezialist:innen entwickelte ein Kompetenzmodell, das Digitalisierung und Nachhaltigkeit inhaltlich miteinander verknüpft, Zukunftsanforderungen als Lernziele formuliert und integriert. Die Anwendung und Erweiterung der KI-basierten Lernaufgaben ist mit einem Baukasten für Lehrkräfte und einem PlugIn für LMS Moodle vorbereitet. Das KI-System steht als Open Source zur VerfügungRöhrig, A., C. Schmidt. 2023. Wie Kompetenzentwicklungen für nachhaltige Entwicklung mit der digitalen Transformation zusammengebracht werden können. INn: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online. Ausgabe 45. https://www.bwpat.de/ausgabe45/roehrig_schmidt_bwpat45.pdf..
Eine der vielen Möglichkeiten, sich als Bürger:in für eine zukunftsgerechte Gesellschaft zu bilden, bietet die Cradle-to-Cradle NGO mit ihren Bündnissen, Regionalgruppen, der Akademie und nicht zuletzt den Weiterbildungen, die allen Interessierten offenstehen: https://ehrenamt.c2c.ngo
Im privaten Bereich standen Bürger:innen neue Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Wege der direkten plattformgestützten Demokratie stimmten Bürger:innen bspw. über die Haushalte ihrer Kommunen ab und zeigten dabei eine klare Bevorzugung von Investitionen in Bildung. Auch unterstützten sie Forscher:innen und andere mit ihrer Expertise, engagieren sich in Klima(bei-)räten und arbeiten an weiteren kommunalen Strategien mit.
Die Berliner Bürger:innen wurden 2015 und erneut 2021 zur Mitgestaltung der sogenannten Smart City Strategie Berlins eingeladen. In sechs Themenfeldern haben Berliner:innen Vorschläge erarbeitet, an deren Umsetzung sie ebenfalls mitarbeiten. https://smart-city-berlin.de/strategie
Flussbad Berlin ist ein weiteres Beispiel, das Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten zusammenführt. Die Entwicklungsphase ist Lernphase aller Beteiligten. https://www.flussbad-berlin.de
Nachdem wir im Jahr 2025 endlich entschieden haben, dass wir gemeinsam den Entitäten eine Stimme verleihen wollen, denen wir sonst nicht zuhören, haben wir begonnen, Wäldern und Flüssen eine Rechtsform zu verleihen. Als juristische Persönlichkeiten gelten nun nicht nur Firmen, sondern auch Naturerscheinungen. Seither hat sich vieles verändert, und auch die Städte sind nicht mehr nur auf Menschen ausgerichtet, sondern laden auch andere Lebewesen ein, sich in ihnen ihr Habitat zu suchen. Wird ein neues Haus errichtet, wird zuvor eine Bestandsaufnahme des Bodens angelegt: Wer wohnt hier, wer soll dazukommen?
Begonnen haben seit 2008 eine Reihe von Ländern, federführend Ecuador mit der Naturrechtsbewegung, gefolgt von Neuseeland, Panama, Bolivien, etc. Im Jahre 2021 entschied der Oberste Gerichtshof von Madras, dass die gesamte Natur des indischen Staates eine Rechtsform erhält. Die Argumentation ging dahin, dass die natürliche Umwelt Teil des Menschenrechts auf Leben ist und dass der Mensch eine Umweltpflicht gegenüber künftigen Generationen hat. Im Oktober 2021 hat der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution verabschiedet, die das Recht auf eine gesunde Umwelt als universelles Menschenrecht anerkennt:“Die Resolution des UN-Menschenrechtsrats zur Anerkennung des Rechts auf eine gesunde Umwelt ist eine Chance, die internationale Verständigung zu umweltbezogenen Menschenrechten voranzubringen.”Deutsches Institut für Menschenrechte. 2021. Internationale Anerkennung eines Menschenrechts auf eine sichere, saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt. Stellungnahme.. S. 8. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/internationale-anerkennung-eines-menschenrechts-auf-eine-sichere-saubere-gesunde-und-nachhaltige-umwelt
Sogar der negative FlynneffektDutton, E., D. van der Linden, R. Lynn. 2016. The negative Flynn Effect: A systematic literature https://doi.org/10.1016/j.intell.2016.10.002 konnte überwunden werden, dank der raschen Umsetzung einer intelligent-nachhaltigen Wirtschaftsweise im globalen Maßstab, die erwünschte Effekte von Dienstleistungen (everything as a service) designbestimmend legal festlegte. Die Einbringung gefährlicher persistenter chemischer Verbindungen in biologische Kreisläufe wurde auf Beschluss der Staatengemeinschaft 2030 beendet. Davon profitierten alle noch lebenden Arten und Ökosysteme insgesamt und mit ihnen auch die Menschen. Das zeigte sich besonders durch abnehmende Krebserkrankungen, wieder zunehmende Fruchtbarkeit und nicht zuletzt auch bei steigenden IQ´s (erfasst als Durchschnittswert).
Der negative Flynneffekt kann als ein Effekt der überschrittenen planetaren Grenze bei chemischen Verschmutzungen mit Auswirkungen auf Menschen angesehen werden.
2022 wurde von einer Gruppe Wissenschaftler:innen um Linn Persson nicht nur nachgewiesen, dass die planetaren Grenzen für Schadstoffe überschritten wurden. Sie formulierten auch eine klare Forderung nach einem internationalen wissenschaftspolitischen Gremium, das als ein Forum für die Aufsicht über Chemikalien und Information über Maßnahmen, die zum Schutz des Erdsystems erforderlich sind, fungieren könntePersson et al. 2022. Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021/acs.est.1c04158&ref=pdf.
Der negative Flynn-EffektDutton, E., D. van der Linden, R. Lynn. 2016. The negative Flynn Effect: A systematic literature review https://doi.org/10.1038/415023a ist angreifbar, da eine relativ junge und noch weniger validierte Sichtweise unter Wissenschaftler:innen in diesem Zukunftsbild. Da sie zugleich für immense Unwägbarkeiten steht, die mit den Risiken der chemischen Umweltverschmutzung für die Menschheit verbunden sind, erscheint es vertretbar, diese Arbeit zu berücksichtigen.