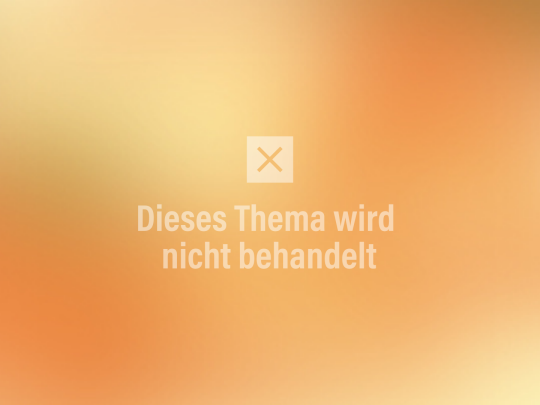Text
Heike Bartholomäus
Lektorat
Gregor Hagedorn
Carla Klocke
Review
Hartmut Graßl
Illustration
–
2040 – Wir haben schon viel erreicht
Die Hochschulbildung ist ein autonomes, bewegliches, offenes und flexibles System, das den Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht wird. Die Hochschulen haben den Wandel in der Arbeitswelt erkannt und Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen entwickelt.
Laut dem Future of Jobs Report 2025 des World Economic Forum führen kürzer werdende Innovationszyklen bis 2030 zu 170 Millionen neuen Jobs – zugleich werden jedoch 92 Millionen Arbeitsplätze durch technologischen Wandel, grüne Transformation, Digitalisierung und demografische Veränderungen wegfallen(vgl. World Economic Forum (2025). Future of Jobs Report 2025. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf . Die damit einhergehende Qualifikationslücke muss durch gemeinsame, schnell wirksame Maßnahmen von Wirtschaft und Bildung geschlossen werden.
Die Hochschulbildung ist ein hochgradig vernetztes, dynamisches System, das sich in Echtzeit an gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen anpasst. Adaptives Lernen ermöglicht es, maßgeschneiderte Bildungsangebote binnen weniger Wochen zu entwickeln und direkt in den Berufsalltag zu integrieren.
Sie fungieren als integrative Bildungsräume, in denen Studierende unterschiedlicher Hintergründe und Qualifikationen zusammenkommen. Diese profitieren von der Vielfalt der Wissenschaftslandschaft, die verschiedene Hochschultypen und Forschungseinrichtungen umfasst.
Ein globales Netzwerk von Hochschulen ermöglicht es, dass Lernende flexibel zwischen Universitäten auf verschiedenen Kontinenten wechseln können – sowohl physisch als auch virtuell. So kann ein Studienmodul in nachhaltiger Stadtplanung in Singapur absolviert, ein KI-gestütztes Praxisprojekt mit einer Universität in Kanada durchgeführt und eine Abschlussarbeit gemeinsam mit Forschenden in Deutschland erarbeitet werden.
Die Studienangebote bestehen aus vielfältigen, anschlussfähigen Lerneinheiten.
In diesem dynamischen Umfeld gestalten die Studierenden eigene Lernwege und bearbeiten gemeinsam mit verschiedenen Disziplinen aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen, sei es durch Spezialisierungsmodule, interdisziplinäre Kurse zu zukünftig geforderten Kompetenzen, sogenannte Future-Skills oder praxisorientierte Projekte. Microcredentials und digitale Zertifikate ermöglichen es ihnen, ihre Kompetenzen kontinuierlich zu erweitern. Künstliche Intelligenz begleitet sie dabei, ihre Lernpfade optimal anzupassen. Virtuelle und hybride Lernformate sind selbstverständlich, sodass wir teilweise unabhängig von Ort und Zeit studieren können. Trotzdem bleibt der Campus wichtig – als Raum für Austausch, interdisziplinäre Forschung und praxisnahe Projekte.
Microcredentials sind nach dem Rat der EU Nachweise über die Lernergebnisse, die eine Lernende bzw. ein Lernender im Rahmen einer weniger umfangreichen Lerneinheit erzielt hat. Diese Lernergebnisse werden anhand transparenter und eindeutig definierter Kriterien beurteilt. Lernerfahrungen, die zum Erhalt von Microcredentials führen, sind so konzipiert, dass sie den Lernenden spezifische Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen vermitteln, die dem gesellschaftlichen, persönlichen, kulturellen oder arbeitsmarktbezogenen Bedarf entsprechen. Microcredentials sind Eigentum der Lernenden, können geteilt werden und sind übertragbar. Sie können eigenständig sein oder kombiniert werden, sodass sich daraus umfangreichere Qualifikationen ergeben. Sie werden durch eine Qualitätssicherung gestützt, die sich an den im jeweiligen Sektor oder Tätigkeitsbereich vereinbarten Standards orientiert.“ (Empfehlung des Rates über einen europäischen Ansatz für Microcredentials für lebenslanges Lernen und Beschäftigungsfähigkeit, 2022, Seite 13,Council of the European Commission (2022). Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability of 16 June 2022 (2022/C 243/02) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H0627(02)
Adaptive KI-Systeme personalisieren Lernpfade individuell und ermöglichen ein Studium, das sich fortlaufend an die individuellen Bedürfnisse anpasst.
Maßgeschneiderte Programme mit berufspraktischen Phasen, Hochschulmodulen und forschungsbasiertem Lernen unterstützen eine persönliche und berufliche Entwicklung der Lernenden. Lebenslanges Lernen ist Teil der akademischen Identität.
Lebenslanges/lebensbegleitendes Lernen als bildungspolitisches Konzept umfasst „alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt“ EU (2000). Memorandum über Lebenslanges Lernen. http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-2000/EU00_01.pdf.
In Verbindung mit Fachkompetenzen gewinnen überfachliche Kompetenzen für den Wandel und die Bewältigung komplexer Aufgaben an Bedeutung.
Kompetenzbasiertes Konzept der Future Skillsvgl. z.B. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. (2021). FUTURE SKILLS 2021 – 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel, Diskussionspapier Nr. 3, https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021McKinsey & Company (2021). Defining the skills citizens will need in the future world of work. https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work#/World Economic Forum (2025). Future of Jobs Report 2025. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf: Diese Kompetenzen umfassen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in den kommenden Jahren – vor dem Hintergrund des Klimawandels, der Digitalisierung & Künstlichen Intelligenz und dem demographischen Wandel – für das Berufsleben und die gesellschaftliche Teilhabe deutlich wichtiger werden. Die Beschäftigten müssen sich mehr als bisher selbstorganisiert auf Anforderungen einstellen, die noch unzureichend bekannt sind und sich mit Lösungen und Methoden auseinandersetzen, die ggf. noch nicht entwickelt sind.
Ein immersives Lernprogramm bereitet Studierende mit XR-Technologien, also kombinierten realen und virtuellen Umgebungen oder Mensch-Maschine-Interaktionen, auf zukünftige Herausforderungen vor. In einer virtuellen Umgebung lösen sie realistische Transformationsszenarien, wie den Aufbau resilienter Städte oder ethische Entscheidungen im Umgang mit autonomen Systemen.
Die Hochschulbildung bereitet nicht mehr nur auf eine spezifische Berufslaufbahn vor, sondern vermittelt breit gefächerte Future Skills – z. B. digitale Kompetenz, kritisches Denken, interdisziplinäres Arbeiten und unternehmerisches Handeln.
Hochschulen und Weiterbildungsanbieter sowie Unternehmen entwickeln gemeinsam Programme, die auf den aktuellen Bedarf des Arbeitsmarktes zugeschnitten sind. Die Hochschulen agieren als regionale Motoren und Transferzentren, die eng mit der Wirtschaft, Kommunen und gesellschaftlichen Akteuren vernetzt sind.
Der Transfer von den und an die Hochschulen bezieht sich einerseits auf die gezielte Weitergabe von Wissen, Technologien und Innovationen aus der Wissenschaft in die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und andererseits den wechselseitigen Austausch, bei dem auch Impulse aus der Gesellschaft in die Hochschulen zurückfließenHochschulrektorenkonferenz (2017). Entschließung der 23. MV der HRK am 14. November 2017. Transfer und Kooperation als Aufgaben der Hochschulen. https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/Entschliessung_Transfer_und_Kooperation_14112017.pdf.
3D-gedruckte Lernräume, d.h. physische Bildungsumgebungen, die mithilfe von 3D-Drucktechnologie erstellt werden, entstehen innerhalb weniger Stunden dort, wo sie gerade gebraucht werden. Hochschulen betreiben eigene Innovationshubs, in denen interdisziplinäre Teams gemeinsam mit lokalen Unternehmen und sozialen Organisationen an gesellschaftlich relevanten Problemlösungen arbeiten.
Wir lernen nicht nur an Hochschulen und Universitäten, sondern auch direkt in Betrieben, Forschungslaboren oder digitalen Co-Learning-Räumen. Hochschulen verstehen sich als Innovationszentren, die Wissen nicht nur vermitteln, sondern aktiv in die und aus der Wirtschaft und Gesellschaft transferieren. Nachhaltigkeit, Aufgaben und Verantwortungen im Bereich des Austauschs mit Gesellschaft und Wirtschaft, der sogenannten Third Mission, sowie Praxisorientierung bestimmen ihr Handeln.
Lernende können Future-Labs nutzen, die von Unternehmen, NGOs und Hochschulen gemeinsam betrieben werden. Dort arbeiten sie an realen Projekten – von der Entwicklung klimaneutraler Technologien bis hin zu ethischen Richtlinien für den Einsatz von KI.
Unsere Finanzierung ist flexibel: Der Staat übernimmt eine Schlüsselrolle in der Sicherung von Bildung als öffentliches Gut. Lebenslang Lernende erhalten persönliche Bildungskonten, die mit staatlichen oder betrieblichen Zuschüssen gefüllt werden.
Ein Blockchain-basiertes System nutzt dezentrale, transparente und fälschungssichere Datenbanken, um Informationen in einer verketteten Struktur (Blöcke) zu speichern, und gewährleistet so die zuverlässige Verwaltung von Bildungsguthaben. Lernende können jederzeit Bildungsangebote abrufen, während Arbeitgeber und öffentliche Institutionen gezielt Weiterbildungen finanzieren können.
Hochschulen und Universitäten haben sich als glaubwürdige und verlässliche Orte etabliert, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe der Studierenden fördern. Egal, ob wir uns spezialisieren, neu orientieren oder weiterentwickeln wollen, wir finden an Hochschulen, in Unternehmen und Bildungsplattformen immer das passende Angebot. Die Hochschulbildung von heute ist offen, vernetzt und dynamisch und begleitet uns ein Leben lang.
2020 – Die Maßnahmen, welche uns auf den Weg brachten
In einer Zeit, in der der Zugang zu Informationen vielfältig ist, müssen Hochschulen aktiv die Bedeutung wissenschaftlicher Bildung betonen, um das Vertrauen der Gesellschaft in wissenschaftliche Erkenntnisse zu stärken. Die Hochschulbildung in Deutschland stand vor großen Herausforderungen: Rückgang der Studierendenzahlen, gesellschaftliche Umbrüche, Wettbewerbsdruck, enge Rahmenbedingungen und Ressourcen sowie Unsicherheiten zur Wissensfreiheit beherrschten das Stimmungsbild.
Stifterverband (2024). Hochschul-Barometer 2024Stifterverband (2024). Hochschul-Barometer 2024. https://www.hochschul-barometer.de/sites/barometer/files/2024-12/hochschul-barometer_2024.pdf.
Hochschulen stellten nicht nur Forschungsergebnisse online, sondern entwickelten „Wissenschaftskommunikationsplattformen“, die in Echtzeit mit der Öffentlichkeit interagieren. Diese Apps bieten personalisierte Inhalte für verschiedene Zielgruppen und ermöglichen direkte Diskussionen über aktuelle Forschungsthemen mit Wissenschaftler:innen.
Das traditionelle Bildungssystem war stark durch eine Versäulung gekennzeichnet, was bedeutet, dass akademische und berufliche Bildung oft isoliert voneinander betrachtet wurden.
Die Segmentierung zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung nach Martin Baethges Konzept des BildungsschismasBaethge, M.; Solga, H. & Wieck, M. (2007). Berufsbildung im Umbruch. Signale eines überfälligen Aufbruchs. beschreibt die problematische Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung durch die unterschiedlichen Systemlogiken, aber auch der KulturenWolter, A.. Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung. Wo steht Deutschland heute? In DENK-doch-MAL.de Das Online-Magazin. https://denk-doch-mal.de/andrae-wolter-durchlaessigkeit-zwischen-beruflicher-und-hochschulischer-bildung-wo-steht-deutschland-heute/#toggle-id-1.
Im Rahmen von Förderprojekten wurden bereits in den 2020er Jahren Lernarchitekturen mit einem durchlässigen Gesamtkonzept für zertifizierbare Qualifizierungsprogramme gemeinsam von Verbünden aus Forschungseinrichtungen, Bildungsträgern und Unternehmen entwickelt. Ein Beispiel aus dem Batteriesektor waren die geförderten Batterie-Kompetenz-Trios, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Diese Verbünde bestanden aus Unternehmen, Bildungsträgern und Forschungseinrichtungen, um in einem sehr schnelllebigen Bereich einen institutionsübergreifenden und transdisziplinären Kompetenzaufbau in sehr kurzer Zeit umzusetzen. Einer dieser Verbünde, das KOMBiH- Konsortium aus Berlin und Brandenburg, entwickelte die notwendigen Qualifizierungen und berücksichtigte dabei unterschiedlichen Anforderungen der beteiligten Akteure sowohl an die berufliche als auch wissenschaftliche Weiterbildung in einem durchlässigen Gesamtkonzept und machte diese in gemeinsamen Zertifizierungen sichtbarKOMBiH – Kompetenzaufbau für Batteriezellfertigung in der Hauptstadtregion.
Diese Trennung und das schwer zu überwindende lineare Modell der Bildungs- und Beschäftigungskarriere erschwerten die Übergänge zwischen verschiedenen Bildungswegen.
Mit den unterschiedlichen Anforderungen der beteiligten Akteure an die berufliche und wissenschaftliche Bildung wurde sich zunächst nur beschränkt auf Projektebene auseinandergesetzt. Das Konzept des „Open University Networked Learning Systems“ wurde eingeführt. Studierende können zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen (universitär, beruflich oder privat) wechseln, ohne ihr Studium zu unterbrechen. Sie sammeln in modularen Lernumgebungen unterschiedliche Qualifikationen, die miteinander kombiniert werden können. Absolvent:innen haben so die Möglichkeit, ein „maßgeschneidertes Studium“ zu verfolgen, das auf individuelle berufliche Ziele und die schnelle Anpassung an den Arbeitsmarkt ausgerichtet ist. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (BTU) hatte mit ihrer Rahmenordnung im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung bereits seit 2022 erste Schritte in Richtung eines vernetzten, selbstgesteuerten Lernsystems unternommen. Durch modulare und flexible Lernangebote aus den Studiengängen, eigene Zertifikatsprogramme und kleinere Microcredentials ermöglichte die BTU eine individuelle und anpassbare Studien- bzw. Bildungsweggestaltung. Die offenen Zugangswege erleichterten den Wechsel zwischen akademischer und beruflicher Bildung und förderten die Vernetzung verschiedener Bildungseinrichtungen.
Zugleich brachte die zunehmende Vielfalt in der Studierendenschaft unterschiedliche Bedürfnisse und Hintergründe und damit auch neue Möglichkeiten des Lernens mit.
Heterogenität der Studierendenschaft, nichttraditionelle Studierende: Im Allgemeinen handelt es sich um Menschen, die aus verschiedenen Gründen ein Studium aufnehmen, die sich von den traditionellen Studierenden unterscheiden (Ziele, Motivation, vielfältige Bildungswege, berufliche Qualifizierung, Familienaufgaben), also in der Regel nicht direkt nach dem Abschluss der Sekundarstufe in die Hochschule eintreten. Die Öffnung der Hochschulen trägt zur Schaffung eines inklusiven und dynamischen Bildungssystems bei, das nicht nur den traditionellen Studierenden, sondern auch nichttraditionellen Studierenden die Möglichkeit bietet, ihre Bildungsziele zu erreichen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das führt zu einer Reihe von Veränderungen und Entwicklungen in der Hochschulbildung und berührt u.a. erweiterte Zugangswege, Anrechnung/Anerkennung von Kompetenzen, eine höhere Vielfalt der Studienformate, Brückenangebote, Gestaltung der Beratung und Begleitung, Integration in die Hochschulkultur, Kooperationen mit der Wirtschaft, Stärkung des Lebenslangen Lernens. Dies erfordert also ein erweitertes Verständnis des tradierten Student Life Cycle.
Eine KI-basierte Lernplattform nutzt maschinelles Lernen, um die Studierenden zu begleiten. Diese Plattform bietet individuelle Lernpfade, um spezifische Wissenslücken zu schließen und Fortschritte sofort zu evaluieren. Studierende erhalten während des Lernprozesses kontinuierliches Feedback und adaptierte Inhalte, die auf ihre Fähigkeiten und Interessen abgestimmt sind. Das System wurde laufend weiterentwickelt, um den Studierenden die effektivste und schnellste Methode des Lernens zu ermöglichen. Dozent:innen arbeiteten daran, inklusives Lehrmaterial zu entwickeln, das für alle zugänglich ist, unabhängig von den jeweiligen persönlichen Voraussetzungen.
Auch die Möglichkeit zur Weiterbildung an Hochschulen spielte eine zunehmend wichtige Rolle in der Bildungslandschaft und sprach nichttraditionell Studierende an.
Unter wissenschaftlicher Weiterbildung (auch akademischer Weiterbildung) wird die „Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme einer Erwerbs- oder Familientätigkeit, wobei das wahrgenommene Weiterbildungsangebot dem fachlichen und didaktischen Niveau der Hochschule entspricht“, verstandenStändige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland KMK, 2001, S. 2, Kultusministerkonferenz (2001). Sachstands- und Problembericht zur „Wahrnehmung wissenschaftlicher Weiterbildung an den Hochschulen“. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2001/2001_09_21-Problembericht-wiss-Weiterbildung-HS.pdf. Der Wissenschaftsrat (2019) spricht sich in seiner „Empfehlung zu hochschulischer Weiterbildung als Teil des lebenslangen Lernens“ für die Bezeichnung als hochschulische statt wissenschaftliche Weiterbildung ausHochschul-Barometer 2024.https://www.hochschul-barometer.de/sites/barometer/files/2024-12/hochschul-barometer_2024.pdf.
Die sich verändernde Studierendenschaft und die Wissens- und Kompetenzanforderungen aus der Wirtschaft sowie die gesellschaftlichen Veränderungen verlangten eine Anpassung der Lehrarchitektur und der didaktischen Ansätze. Digitale Technologien ermöglichten bereits in den 2020er Jahren neue Lehr- und Lernformate, stellten jedoch auch hohe Anforderungen an die technische Infrastruktur der Hochschulen sowie an die digitale Kompetenz der Lehrenden und Studierenden.
Um diese Herausforderungen zu erfüllen, begannen Hochschulen, neue Lernformate anzubieten, die auf praxisnahes Lernen in Kooperationen mit der Wirtschaft setzten. Initiativen zur Förderung des lebenslangen Lernens und zum Erwerb von Microcredentials gewannen zunehmend an Bedeutung, wodurch die Studierenden besser auf die Anforderungen des sich ändernden Arbeitsmarktes vorbereitet wurden.
Um die Hochschulbildung zukunftsorientiert zu gestalten, wurden in den letzten Jahren folgende gezielte Maßnahmen ergriffen:
01 – Hochschulen haben neben ihren Aufgaben Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung eine stärkere Ausrichtung auf gesellschaftliche Bedürfnisse und praktische Relevanz vollzogen.Quelle: Aufgaben von Hochschulen im Hochschulrahmengesetz: HRG § 2 Abs. 1, 7 in Hochschulrahmengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Januar 1976, in: Bundesgesetzblatt Teil I, Bonn 1976, S. 185–206
02 – Die strikte Trennung zwischen diesen Bildungswegen wurde Schritt für Schritt überwunden, was ein komplexer und langwieriger Prozess war. Durch praxisnahe Studienformate und Kooperationsprojekte konnten Brücken zwischen Theorie und Praxis gebaut und die Beschäftigungsfähigkeit der Absolvent:innen erhöht werden
Erläuterung: Die Bologna-Zielsetzung hat Employability als explizites Bildungsziel ausgewiesen, und die „Ausbildungsaufgabe“ der Hochschulen wurde bereits 1976 im Hochschulrahmengesetz verankert..
03 – Diese Initiativen förderten nicht nur das Lernen, sondern auch den wechselseitigen Wissenstransfer.
04 – Eine diverser werdende Hochschullandschaft, in der die klassischen Hochschultypen durch neue Modelle ergänzt wurden, unterstützte diese Entwicklungen.
05 – Der Wissenskanon der Hochschulen wurde um Future Skills erweitert, sodass der Fokus nicht mehr nur auf spezifischem Fachwissen lag, sondern auch auf interdisziplinären Kompetenzen, die für die Zukunft relevant sind.
Hochschulen sahen sich der komplexen Aufgabe gegenüber, ihre Studierenden und Lehrenden angemessen auf sich ständig verändernde Rahmenbedingungen vorzubereiten. Sie entwickelten interdisziplinäre Programme, die gezielt die Future Skills der Studierenden und des Lehrpersonals fördern. Diese Programme kombinierten klassische akademische Inhalte mit praktischen Fähigkeiten wie kritisches Denken, digitale Kompetenz, interdisziplinäre Teamarbeit und agiles Arbeiten. Gleichzeitig wurden Lehrende gezielt in modernen didaktischen Methoden und digitalen Technologien geschult, um Future Skills nicht nur zu vermitteln, sondern auch selbst aktiv weiterzuentwickeln. Bereits Ende der 2010er Jahre entstanden verschiedene Kompetenzmodelle für Zukunftskompetenzen – beispielsweise das Future Skill Framework vom Stifterverband und McKinsey & Company McKinsey & Company (2021). Defining the skills citizens will need in the future world of work. https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work#/ oder das Modell der Arbeitsgruppe NextEducation an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg unter der Leitung von Prof. Dr. Ulf-Daniel EhlersEhlers, U.-D. (2020): Future Skills. Lernen der Zukunft – Hochschulen der Zukunft. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-29297-3. Die Hochschulen beschäftigten sich intensiv mit der Frage, wie sich das Thema Future Skills systematisch in die Lehre integrieren lässt. Ein Beispiel entstand an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg: Ein modulares Qualifizierungsangebot für das Hochschulpersonal unterstützte gezielt die Vermittlung von Future Skills im Studium.
06 – Hochschulen haben in digitale Infrastruktur investiert und innovative Lehr- und Lernmethoden entwickelt, um das Lernen flexibler und interaktiver zu gestalten. Diese Veränderungen ermöglichen es Studierenden, ihre Lernwege individuell zu gestalten und verschiedene Formate wie Online-Kurse, hybride Modelle und Blended Learning zu nutzen.
07 – Das Konzept des lebenslangen Lernens wurde umfassend in die Hochschulbildung und die dafür notwendigen Strukturen des Learning-Life-Cycle integriert.
Der Student Life Cycle beschreibt die verschiedenen Phasen, die eine Person im Verlauf ihres Studiums durchläuft – von der ersten Orientierung bis zum Berufseinstieg. Ein erweitertes Verständnis berücksichtigt, dass der Student/Learning Life Cycle nicht immer geradlinig verläuft, sondern flexibel verschiedene Bildungswege ermöglichen kannHochschulrektorenkonferenz (2024). Zusammenarbeit der Bildungsbereiche stärken – Fachkräfte sichernEntschließung der 38. HRK-Mitgliederversammlung am 14.5.2024. https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/2024-05-14_HRK-MV_Entschliessung_Fachkraefte.pdf.
08 – Die Lehre und das Lernen profitierten von der Diversität der Studierenden. Hochschulen entwickeln Programme, die auf die unterschiedlichen Hintergründe, Bedürfnisse und Qualifikationen der Studierenden eingehen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, eine inklusive Lernumgebung zu schaffen, in der alle Studierenden die gleichen Chancen haben, erfolgreich zu sein.
09 – Hochschulen führten Mikroabschlüsse und flexible Bildungsangebote ein, die es den Lernenden ermöglichen, vorhandenes Wissen zu vertiefen, kontinuierlich neue Kompetenzen zu erwerben oder auch sich komplett neu zu orientieren.
Die Anerkennungs- und Anrechnungspraxis an Hochschulen regelt den Umgang mit bereits erworbenen Studienleistungen und Qualifikationen. Anrechnung bezieht sich auf Kenntnisse und Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulwesens erworben wurden, während Anerkennung die Kompetenzen, Qualifikationen und Leistungen betrifft, die an Hochschulen erzielt wurden. Damit verringerten sich Studienabbrüche und führten zu Neuorientierungen. Die hochschulische Weiterbildung wurde nahtlos in die Hochschulbildung integriert.
10 – Innovative Finanzierungsmodelle wurden eingeführt, die das bisherige System der Semesterbeiträge oder der gebühren-/entgeltpflichtigen Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung ersetzen.
Insgesamt stellten diese Maßnahmen sicher, dass die Hochschulbildung in Deutschland nicht nur anpassungsfähig und zukunftsorientiert ist, sondern auch die Entwicklung von Fachkräften unterstützt, die in einer dynamischen und komplexen Welt erfolgreich agieren können.