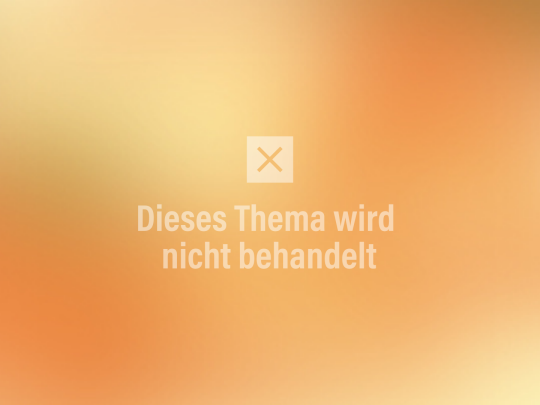Text
Harald Schuster
Ute Symanski
Lektorat
Carla Klocke
Review
Hartmut Graßl
Illustration
–
2040 – Wir haben schon viel erreicht
Bis 2040 hat sich der Verkehr grundlegend gewandelt. Er ist nicht mehr nur ein Mittel zum Zweck, sondern auch viel stärker ein sozialer Raum, der Begegnung, Austausch und Gemeinschaft fördertSheller, M., & Urry, J. (2006). The New Mobilities Paradigm. Environment and Planning A: Economy and Space, 38(2), 207-226. https://doi.org/10.1068/a37268. Anstelle von vielen Fahrzeugen mit meist nur einer Person prägen Fußgänger:innen und Radfahrer:innen sowie flexible und gemeinschaftsorientierte Verkehrsmittel und andere Mobilitätslösungen das Bild der (Innen)-Städte
Etymologische Entwicklung des Wortes „Verkehr“Pfeifer, W., & Wiegand, F. (1993). Verkehr. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). Retrieved 05.02.2025, from https://www.dwds.de/wb/etymwb/Verkehr: Das Wort stammt aus dem Mittelhochdeutschen „verkēren“. Es setzt sich zusammen aus dem Präfix „ver-“ (in der Bedeutung von anders machen, wechseln) und „kehren“ (von althochdeutsch „kehran“ = wenden, drehen). Bereits im 16. Jahrhundert entwickelte sich die Bedeutung von „verkehr“ im Sinne von „Umgang, Austausch zwischen Menschen“, etwa in Handelsbeziehungen oder gesellschaftlichen KontaktenGrimm, J., & Grimm, W. (1854–1961). VERKEHR, m. n. bis VERKEHRNISZ, n. Deutsches Wörterbuch. 16 Bände in 32 Teilbänden. Retrieved 03.05.2025, from https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemid=V02048.
Bis heute spricht man von „gesellschaftlichem Verkehr“, wenn man zwischenmenschliche Interaktion meint. Auch der Austausch von Waren, Dienstleistungen oder Zahlungsmitteln (z. B. Handelsverkehr, Zahlungsverkehr) wird unter „Verkehr“ subsumiert. In diesem Sinne verstehen wir unter Verkehr nicht nur Transport (z. B. Straßenverkehr), sondern auch eine Form des Kontakts, der Interaktion und des sozialen Austauschs“.
In Innenstädten bewegen sich Menschen nahtlos zwischen verschiedenen Mobilitätsformen: Mit autonomen E-Bussen, Fahrrädern, dem Zufußgehen und gemieteten Fahrzeuge schaffen Menschen ein engmaschiges NetzJensen, O. B. (2013). Staging Mobilities. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203070062.
Diese Verkehrsmittel funktionieren auch als soziale Orte. Mobilitätsstationen und „soziale“ Buchten im öffentlichen Raum sind gleichzeitig Begegnungszonen, ausgestattet mit urbanen Möbeln und begrünten Wartebereichen, die die Menschen dazu einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es gibt zudem offene Werkstätten, ausgestattet mit sog. Fahrradreparatursäulen. Dort wird den Menschen die Möglichkeit geboten, gemeinsam Fahrräder zu reparieren.
Öffentliche Mobilitätsstationen und soziale Buchten haben sich in Gemeinschaftsräume verwandelt: Menschen steigen in Verkehrsmittel ein, oder sie steigen umKaufmann, V. (2020). Social implications of spatial mobilities. In O. B. Jensen, C. Lassen, V. Kaufmann, M. Freudendal-Pedersen, & I. S. Gøtzsche Lange (Eds.), Handbook of Urban Mobilities (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351058759. Diese Orte sind darüber hinaus Transfer-Schnittstellen, und sie sind Aufenthaltsorte, Lesecafés oder Orte für spontane VeranstaltungenCidell, J. (2020). Moving and pausing. In O. B. Jensen, C. Lassen, V. Kaufmann, M. Freudendal-Pedersen, & I. S. Gøtzsche Lange (Eds.), Handbook of Urban Mobilities (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351058759. Menschen treffen sich, lernen neue Perspektiven kennen und beteiligen sich an lokalen Initiativen, die über Bildschirme oder Mitmachstationen beworben werden. Die Mobilität von 2040 ist inklusiv und ermöglicht allen Menschen eine aktive Teilhabe am städtischen LebenGehl, J., & Rogers, R. (2013). Cities for People. Island Press.. Öffentliche Nahverkehrsmittel sind kostenlos, finanziert durch die dafür ausgestatteten Gemeinden. Die elektrischen Fahrzeuge sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen: von barrierefreien Ein- und Ausstiegen bis hin zu personalisierbaren Innenräumen, die Ruhe oder soziale Interaktion ermöglichenInstitute for Transportation & Development Policy. (2024). Access for All Through Universal Accessibility (Cities for All Through Universal Accessibility, Issue. https://itdp.org/wp-content/uploads/2024/10/ITDP-TUMI_Access-for-All-Visual-Brief_Dec-2024.pdf.
Im Zusammenhang mit sozialer Interaktion an Orten jenseits von Zuhause und Arbeitsplatz wurde in der bisherigen Forschung häufig auf das Konzept der „dritten Orte“Oldenburg, R. (1989). The great good place: Cafés, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day. Paragon House. verwiesen, das sich auf quasi öffentliche Räume wie Cafés, Kneipen, Gemeindezentren oder Bibliotheken beziehtAelbrecht, P. (2016). ‘Fourth places’: the contemporary public settings for informal social interaction among strangers. Journal of Urban Design, 21(1), 124-152. https://doi.org/10.1080/13574809.2015.1106920. Die zeitgenössische Forschung ergänzt das Konzept um „vierte Orte“Aelbrecht, P. (2016). ‘Fourth places’: the contemporary public settings for informal social interaction among strangers. Journal of Urban Design, 21(1), 124-152. https://doi.org/10.1080/13574809.2015.1106920. Vierte Orte haben ein hohes Maß an öffentlicher Zugänglichkeit und können räumlich, zeitlich und funktional sowohl privat wie auch öffentlich genutzt werden. Oft sind es Orte ohne Konsumzwang mit freier Zugänglichkeit. Diese Orte funktionieren als soziale BegegnungsorteManthe, R. (2024). Demokratie fehlt Begegnung: über Alltagsorte des sozialen Zusammenhalts. transcript.. Das Konzept der „vierten Orte“ lässt sich auch auf Mobilitätsräume übertragenBanister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15(2), 73-80. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005.
Während Menschen auf ihr nächstes Verkehrsmittel warten, oder wenn sie ihre Rad- oder Fußwegeketten unterbrechen, können sie an urbanen Gärten arbeiten, gemeinsam kochen oder an offenen Werkstätten teilnehmen.
Inklusive Mobilität bedeutet, dass alle Menschen – unabhängig von Alter, Einkommen, Geschlecht, körperlicher oder kognitiver Einschränkung – gleichberechtigten Zugang zu Verkehrsmitteln und öffentlichem Raum haben. Sie ist essenziell für soziale Teilhabe, wirtschaftliche Integration und die Verwirklichung eines gerechten StadtbildesRicci, M., Parkhurst, G., & Jain, J. (2016). Transport Policy and Social Inclusion. Social Inclusion, 4(3), 1-6. https://doi.org/10.17645/si.v4i3.668. Barrieren der Mobilität können physischer, finanzieller oder sozialer Natur sein. Fehlende barrierefreie Infrastruktur, unbedacht abgestellte Fahrzeuge, hohe Fahrpreise oder diskriminierende Stadtplanung schließen oft Ältere, Behinderte und Arme von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ausLucas, K. (2012). Transport and social exclusion: Where are we now? Transport Policy, 20, 105-113. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013.
Viele Straßen sind nicht länger in erster Linie Durchgangsorte, sondern urbane LebensräumeSchwanen, T. (2022). Inequalities in Everyday Urban Mobility. Working Paper Series, GOLD VI 09. https://gold.uclg.org/sites/default/files/09_inequalities_in_everyday_urban_mobility_by_tim_schwanen_0.pdf.
Ehemalige Parkplätze wurden in Mikroparks oder Sportflächen umgewandelt. Mobilität ist mit Teilhabe, Vernetzung und Lebensqualität verbundenDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2024). Hamburg Charter for Inclusive and Just Mobility. Bonn, und nicht mehr mit Stress und Isolation.
Insgesamt hat sich das Verständnis von Bewegung verändert: Es geht darum, soziale Räume zu gestalten, die Begegnungen fördern und das Stadtleben bereichern. Mobilität ist ein lebendiger, sich ständig wandelnder sozialer Raum – ein kollektives Erlebnis, das Stadtbewohner*innen miteinander verbindet. Mobilität 2040 ist ein gemeinschaftlicher Raum, in dem das soziale Miteinander im Mittelpunkt steht.
Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten
Die Gestaltung von Mobilität hat einen tiefgreifenden Einfluss auf das soziale Leben in Städten. Während herkömmliche Verkehrsplanung lange Zeit auf den schnellen Transport von A nach B ausgerichtet war, setzten sich bereits in den 2020er Jahren neue Konzepte durch, die Mobilität als sozialen Raum begreifente Brömmelstroet, M., Anna, N., Milos, M., Dimitris, M., Antonio, F., Ersilia, V., Catarina, C., Joao, d. A. e. S., & and Papa, E. (2022). Have a good trip! Expanding our concepts of the quality of everyday travelling with flow theory. Applied Mobilities, 7(4), 352-373. https://doi.org/10.1080/23800127.2021.1912947. Der öffentliche Raum soll auch ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der aktiven Teilhabe sein. Aktive Mobilität, also Fuß- und Radverkehr, spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie reduziert Barrieren, fördert das Miteinander und stärkt die lokale NachbarschaftSchuster, H., van der Noll, J., & Rohmann, A. (2023). Orientation towards the common good in cities: The role of individual urban mobility behavior. Journal of Environmental Psychology, 91, 102125. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2023.102125.
aktive Mobilität (zu Fuß oder mit dem Rad): In den Niederlanden wird schon heute ein Viertel aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt, in Deutschland sind es nur 11 %. Zu Fuß werden 22 % erreicht (wo? in D? in den NL?)BAG. (2021). Gleitende Mittelfristprognose für den Güter- und Personenverkehr 2020/2021. Bundesamt für Güterverkehr.. Sich zu Fuß und mit dem Fahrrad bewegen, ist auch für Kommunen und Einzelpersonen vorteilhaft, da das Stau und Lärm mindert sowie die Umwelt schont. Zufußgehen, lässt die Umgebung mit allen Sinnen erleben, den Weg unmittelbar wechseln und erhöht die Chance zum Gespräch. Für kürzere Strecken unter 2 km ist das Gehen in Deutschland die häufigste Fortbewegungsart (62 %), während für etwas längere Strecken zunehmend das Fahrrad genutzt wirdNobis, C., Kuhnimhof, T., Follmer, R., & Bäumer, M. (2019a). Mobilität in Deutschland – Zeitreihenbericht 2002 – 2008 – 2017. Studie von infas, DLR, IVT und infas 360 [Mobility in Germany – Time Series Report 2002 – 2008 – 2017. Study by infas, DLR, IVT and infas 360]. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur [Ministry of Transport and Digital Infrastructure].. Ehemalige Parkplätze wurden in Mikroparks oder Sportflächen umgewandelt. Mobilität ist mit Teilhabe, Vernetzung und Lebensqualität verbundenDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2024). Hamburg Charter for Inclusive and Just Mobility. Bonn, und nicht mehr mit Stress und Isolation.
Fußgänger:innen und Radfahrer:innen entwickeln ein reichhaltigeres „Bild der Stadt“Lynch, K. (1960). The image of the City. MIT Press.. Sie erleben die soziale Vielfalt und kulturelle Heterogenität des städtischen Lebens, was zu einer stärkeren emotionalen Bindung zwischen den Menschen und ihrer Nachbarschaft führtJungnickel, K., & Aldred, R. (2014). Cycling’s sensory strategies: How cyclists mediate their exposure to the urban environment. Mobilities, 9(2), 238-255. https://doi.org/10.1080/17450101.2013.796772.
Aktive Mobilität und Orientierung am Gemeinwohl“ Eine emotionale Bindung gilt als Vermittler für bürgerschaftliches Engagement. Menschen, die sich unmotorisiert fortbewegen, erleben eine stärkere Orientierung am Gemeinwohl als die MotorisiertenStefaniak, A., Bilewicz, M., & Lewicka, M. (2017). The merits of teaching local history: Increased place attachment enhances civic engagement and social trust. Journal of Environmental Psychology, 51, 217-225. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.03.014. Die Entstehung einer Bewegung für direkte Demokratie in Deutschland im Jahr 2016, die sich der Förderung des Radverkehrs verschrieben hatte, ist daher nicht als zufällig zu betrachten. Bis November 2022 hatten bereits mehr als eine Million Menschen in Deutschland ihre Stimmen für mehr Fahrradmobilität und eine bessere Fahrradinfrastruktur abgegebenSymanski, U., & Schuster, H. (2024). Eine Million Unterschriften – Radentscheide schreiben Demokratiegeschichte. In H. K. Heußner, A. Pautsch, F. Rehmet, & L. Kiepe (Eds.), Mehr direkte Demokratie wagen: Volksentscheid und Bürgerentscheid – Geschichte, Praxis, Vorschläge (pp. 275 – 284). Lau-Verlag..
Gelingensbedingungen. Die Transformation der Verkehrsinfrastruktur zugunsten eines flexiblen, vernetzten und gemeinschaftsorientierten Verkehrs erfordert signifikante Investitionen. Während der motorisierte Individualverkehr über mehrere Jahrzehnte mit Milliardenbeträgen gefördert wurde – „autogerecht“: sei es durch den Straßenbau, Steuervergünstigungen oder Parkraumsubventionen – muss nun eine gezielte Umschichtung der Mittel erfolgen, um nachhaltige Mobilitätsformen zu stärken. Allerdings stößt dieser Wandel auf Widerstand, insbesondere vonseiten derer, die vom bisherigen System profitieren. Um die Akzeptanz für die erforderlichen Veränderungen zu erhöhen, sind Strategien erforderlich, die die Attraktivität und Zukunftsorientiertheit der Alternativen herausstellen. Ein weiteres Argument, das häufig vorgebracht wird, ist der drohende Verlust von Industriearbeitsplätzen, insbesondere in der Automobilbranche. Es kann jedoch gezeigt werden, dass ein solcher Wandel in anderen Strukturen und Industriebranchen nicht zwangsläufig zu Arbeitsplatzabbau führt, sondern vielmehr eine zukunftsorientierte Entwicklung einleitet. Der Umbau der Städte ist zweifellos eine Herausforderung, die nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen geboten istStuhde, S., & Panagos, G. (2023). Einführung: Das Scheitern und die Agile Transformation. In Müssen agile Transformationen scheitern? : Validiertes Lernen als Merkmal einer erfolgreichen Agilisierung (pp. 1-30). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65982-3_1.
Bereits in den 2020er Jahren zeigten zwei Stadtplanungsansätze besonders großes Potenzial, diese Vision zu verwirklichen: die 15-Minuten-Stadt und Superblocks. Beide Konzepte setzen darauf, Mobilität neu zu denken und Städte so zu gestalten, dass sie Menschen in den Mittelpunkt stellen – mit kurzen Wegen, attraktiven Aufenthaltsräumen und einer nachhaltigen, sozial inklusiven Verkehrsinfrastruktur.
15-Minuten-Stadt. Das Konzept der 15-Minuten-Stadt beschreibt eine Stadt, in der alle wesentlichen Bedürfnisse – Wohnen, Arbeiten, Bildung, Gesundheitsversorgung, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeit – innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sindMoreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities, 4(1), 93-111. https://www.mdpi.com/2624-6511/4/1/6.
Die Vorteile sind erstens eine Zunahme der Begegnungen und Beziehungen zwischen Menschen. Durch die kürzeren Wege und die Förderung lokaler Infrastruktur verbringen Menschen mehr Zeit in ihrer Nachbarschaft. Dies stärkt die Beziehungen und schafft ein Gefühl der GemeinschaftSchuster, H., van der Noll, J., & Rohmann, A. (2023). Orientation towards the common good in cities: The role of individual urban mobility behavior. Journal of Environmental Psychology, 91, 102125. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2023.102125. Zweitens wird die Nachbarschaft als sozialer Raum genutzt: Straßenräume werden umgestaltet, um Raum für Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und öffentliche Plätze zu schaffen, anstatt für Autos, und drittens entsteht mehr Gleichberechtigung, Teilhabe und Inklusion in der (und durch die) Mobilität: Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ältere Personen oder einkommensschwache Gruppen profitieren von der besseren Erreichbarkeit lebensnotwendiger Einrichtungen.
Paris ist eine der Vorreiterstädte, die das Konzept aktiv umsetzt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo setzt verstärkt auf die Umwandlung von Straßen in Fahrradwege, die Begrünung von Plätzen und die Dezentralisierung von StadtteilenPapas, T., Basbas, S., & Campisi, T. (2023). Urban mobility evolution and the 15-minute city model: from holistic to bottom-up approach. Transportation Research Procedia, 69, 544-551. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.02.206. Portland, Oregon, USA verfolgt mit dem „20-Minuten-Stadt“-Ansatz ein ähnliches Ziel: Die Stadt entwickelt Quartiere, in denen Wohnen, Arbeiten und Freizeit nah beieinanderliegenMcNeil, N. (2011). Bikeability and the 20-min Neighborhood:How Infrastructure and Destinations Influence Bicycle Accessibility. Transportation Research Record, 2247(1), 53-63. https://doi.org/10.3141/2247-07. ACHTUNG: Wir haben 2040. Und da ist Anne Hidalgo wahrscheinlich NICHT MEHR Bürgermeisterin von Paris. Dto. für Portland, Oregon.
Superblocks: Minimierung Autoverkehr, Maximierung sozialer Raum. Das Konzept der Superblocks wurde von Salvador Rueda in Barcelona entwickelt. Hierbei werden mehrere Straßenblöcke zu einem verkehrsberuhigten Gebiet zusammengefasst, in dem der Autoverkehr minimiert wird und Fußgänger:innen und Radfahrer:innen Vorrang habenRueda, S. (2019). Superblocks for the Design of New Cities and Renovation of Existing Ones: Barcelona’s Case. In M. Nieuwenhuijsen & H. Khreis (Eds.), Integrating Human Health into Urban and Transport Planning: A Framework (pp. 135-153). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74983-9_8. Die Vorteile sind erstens die Rückgewinnung des öffentlichen Raums. So werden Parkplätze in Grünflächen, Spielplätze oder Sitzbereiche umgewandelt, die Menschen zum Verweilen und Austausch einladen. Zweitens steigt die Luftqualität, und es gibt weniger Lärm, wie Studien zeigenMueller, N., Rojas-Rueda, D., Khreis, H., Cirach, M., Andres, D., Ballester, J., Bartoll, X., Daher, C., Deluca, A., Echave, C., Mila, C., Marquez, S., Palou, J., Perez, K., Tonne, C., Stevenson, M., Rueda, S., & Nieuwenhuijsen, M. (2020). Changing the urban design of cities for health: The superblock model. Environ Int, 134, 105132. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105132; drittens stärkt es lokale Geschäfte, da autofreie Zonen den lokalen Einzelhandel stärken, und viertens wächst die soziale Teilhabe für alle, da ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den öffentlichen Raum sicherer und ohne Barrieren nutzen können. Barcelona hat bereits über sechs Superblocks eingerichtet, weitere 503 sind in Planung. Berlin testet 2025 sog. „Kiezblocks“ nach dem Vorbild Barcelonas, um Quartiere verkehrsberuhigt und lebenswerter zu gestalten, und London experimentiert mit „Low Traffic Neighborhoods“, die ähnlich funktionieren.
Die 15-Minuten-Stadt und Superblocks zeigten, wie Städte Mobilität neu organisieren können, um sie lebenswerter, nachhaltiger und sozial inklusiver zu machen. Indem sie aktive Mobilität priorisieren und den öffentlichen Raum als Begegnungsort definieren, schaffen sie eine Grundlage für eine gerechtere Stadtentwicklung. Bis 2040 konnten diese Konzepte zur neuen Norm werden – und Städte, die Mobilität als sozialen Ort begreifen, zur Realität machen.