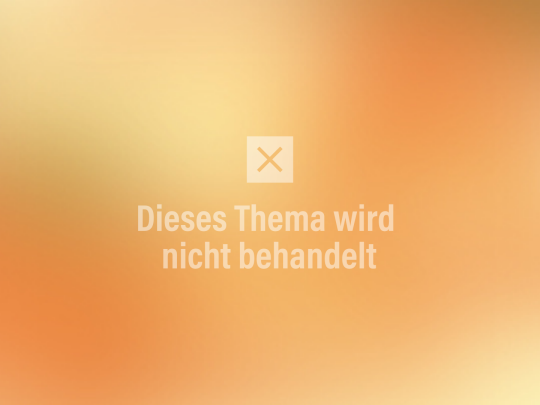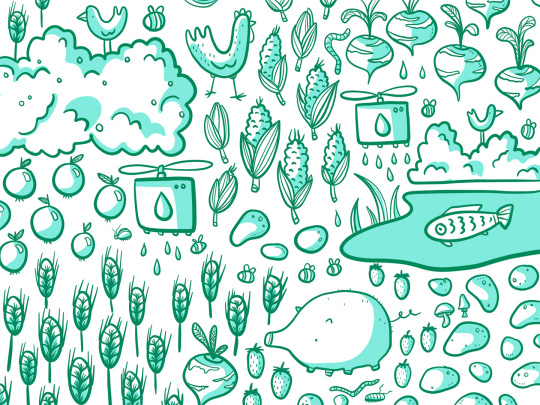Text
–
Lektorat
–
Review
–
Illustration
–
Schreib mit an diesem Text!
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
diese Seite ist noch nicht final.
Wenn Du durch Deinen eigenen Fachhintergrund Kompetenz für dieses Thema mitbringst und bei der Weiterentwicklung der Texte helfen möchtest, dann schreib uns unter scientists@zukunftsbilder.net .